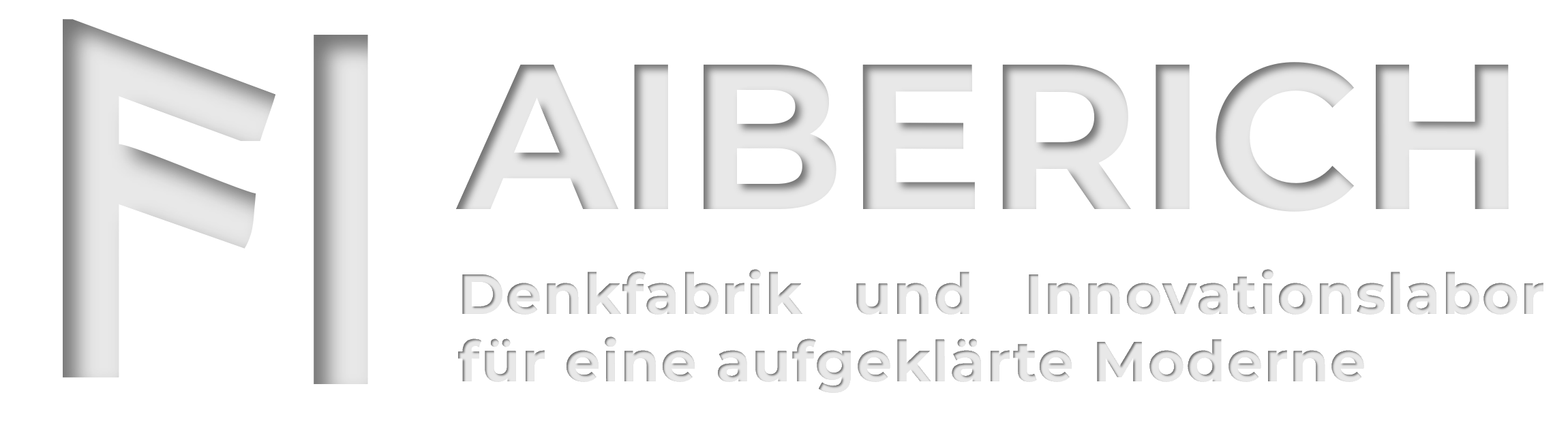Über Aiberich

Im Ring der Niebelungen ist Alberich der Antagonist, in den Wagner sowohl seine Ablehnung der Industrialisierung wie auch seinen Antisemitismus hineinprojiziert. Diese urdeutsche Skepsis gegenüber Moderne und Technik hat sich gehalten. Technologie und die dadurch ermöglichte gesellschaftliche Modernisierung wird von vielen als Bedrohung wahrgenommen. Diese Tendenz hat sich im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (AI) eher noch verstärkt.
Aiberich versteht sich als Denkfabrik und Innovationslabor, das sich einem anderen Blick auf Technologie und gesellschaftliche Modernisierung verpflichtet fühlt. Emanzipation und Aufklärung hängen eng mit den technologischen Möglichkeiten der Moderne zusammen. Im Interesse einer aufgeklärten und emanzipatorischen Moderne gilt es daher, diesen Zusammenhang zu betonen und seine Einbettung in die gesellschaftliche Wirklichkeit zu verteidigen.
Techné ernst genommen
Ein naiver Fortschrittsoptimismus verkennt jedoch leicht, dass Technologie ein Eigenleben entwickelt und der kritischen Einbindung in die gesellschaftliche Wirklichkeit bedarf. Wir betrachten Technikskepsis und -kritik daher nicht als bloß falsche Sichtweise, sondern bemühen uns, auch die problematischen Aspekte der technologischen Moderne zu sehen.
Das betrifft einerseits die globalen Folgen des Technologieeinsatzes, etwa der durch die industrielle Technik bzw. dem damit eng verbundenen Verbrennen fossiler Brennstoffe verursachte Klimawandel. Ebenso bestimmt die Verfügbarkeit von als Kapital geronnener Technologie letztendlich über die Lebensmöglichkeiten der Bewohner einer Region. In diesem Sinne verdient der Technologieeinsatz als eine wesentliche Determinante der problematischen Transformation von Ökosystemen und der globalen sozialen Ungleichheit eine kritische Würdigung.
Andererseits hat der Technologieeinsatz im Kleinen und Alltäglichen einen transformativen Charakter. Der Sinn von Technologie ist es, Menschen Arbeit abzunehmen. Das bedeutet auch, dass Technikeinsatz stets den Handlungsspielraum von Menschen in bestimmten Bereichen einschränkt. Das ist es, was Ted Kaczynski oder Jacques Ellul meinen, wenn sie davon sprechen, dass Technik menschliche Freiheit einschränkt.
Wir glauben jedoch, dass die kritischen Aspekte des Technologieeinsatzes deren gesellschaftliche Bedeutung nicht erschöpfen. Aiberich ist ein großes „Ja, aber“, das versucht die Kritik an Technik und ihrem Einsatz ernst zu nehmen und trotzdem auf dem emanzipatorischen Potenzial zu bestehen.
Demokratische Technik
Der wichtigste Bestandteil dieser Perspektive ist unsere Vorstellung einer demokratisierten Technologielandschaft. Ähnlich wie die Creative Commons Bewegung glauben wir daran, dass Hochtechnologie jedem offenstehen sollte. KI-gestützte Industrie, Materialforschung durch Quantencomputing und personalisierte Medizin sollten nicht nur spezialisierten und elitären Unternehmen zur Verfügung stehen, sondern jedermann. Nur dann, wenn diese Technologien von einer kritischen Öffentlichkeit verstanden werden und diesen auch zur Verfügung stehen, kann es einen ernstzunehmenden Diskurs über deren Potenzial und deren Gefahren geben.
Abgesehen davon darf Hochtechnologie nicht nur in elitären Zirkeln vorkommen. Weder amerikanische Techkonzerne noch zugangsbeschränkte DeepTech-Unternehmen dürfen Technologien monopolisieren. Sie muss jedem zur Verfügung stehen.
Daher engagieren wir uns bei der konsequenten Demokratisierung von Hochtechnologie in drei Bereichen:
- Wir leisten Aufklärung über Technologien selbst, etwa über KI-Technologien, Quantencomputing, Biotech, Quantenchemie, Fintech, u.v.a.
- Wir leisten Aufklärung über die Auswirkungen von DeepTech-Technologien auf makroökonomischer, betrieblicher, kultureller oder gesellschaftlicher Ebene.
- Wir machen selbst Technologie verfügbar.
Denkfabrik & Innovationslabor
In diesem Sinne begreifen wir uns sowohl als Denkfabrik, die sich analytisch und kritisch mit den emanzipatorischen Möglichkeiten von Hochtechnologie auseinandersetzt. Zugleich sind wir ein Innovationslabor, in dem diese Hochtechnologien auch wesentlich mitgestaltet werden sollen.
Daher beschäftigen wir uns mit einer ganzen Reihe von Technologien und ihren Anwendungsgebieten, etwa:
- Variationellen Quantenalgorithmen für das Quantum Machine Learning und in der Quantenchemie, insbesondere für Material- und Pharmaforschung
- Kontradiabatischem Treiben als Möglichkeit zur Lösung anspruchsvoller Optimierungsprobleme, etwa bei der RNA-Faltung, in der Logistik oder für Finanzanlagen
- Multi-Agent Reinforcement Learning als zentraler Technologie der Robotik, in der Logistik und in der Rüstungsindustrie (Drohnennavigation)
- Sensorfusion als einer wesentlichen Technologie zur Steuerung autonomer Vehikel und Roboter
- Blockchain als zentraler Technologie für Fintech, die dezentrale Finanzwirtschaft und in der staatlichen Verwaltung
Innovations- und Komplexitätsökonomie
Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit innovationsökonomischen Fragestellungen. Besonders in Deutschland, das traditionell von neoklassischen und an der Betriebswirtschaft ausgerichteten Vorstellungen dominiert wird, haben es heterodoxe Vorstellungen zur Volkswirtschaftslehre schwer. Gerade der Bereich der Hochtechnologie und der Innovationsprozesse werden von neoklassischen Ökonomen als exogene Phänomene aus der ökonomischen Analyse ausgeschlossen.
Dabei ist es offenkundig, dass Innovationsprozesse und Produktionsprozesse im Kern der ökonomischen Aktivitäten stehen und umgekehrt die wirtschaftlichen Bedingungen großen Einfluss auf Innovationsprozesse nehmen. Es spricht sehr viel dafür, dass Innovation und Technologie endogene Effekte sind und man vielmehr die Ökonomie von der Technik her denken sollte. Daher herrscht im deutschen Diskurs gerade in einem der oder vielleicht sogar dem wesentlichsten Bereich der Ökonomie eine große Leerstelle.
Da die makroökonomischen Prozesse in zentraler Weise damit zusammenhängen, wie Technologie gesellschaftlich eingebettet wird und ob sich ein Fenster der Emanzipation öffnet, spielt die ökonomische Analyse eine große Rolle für Aiberich.
Aiberich fühlt sich der Tradition der neoschumpeterianischen Komplexitätsökonomie verpflichtet und möchte die Lücke füllen, die zu Innovationsökonomischen Fragestellungen in Deutschland herrscht. Daher besteht ein nicht unwesentlicher Bestandteil unserer Arbeit in der Auseinandersetzung und Analyse solcher Fragestellungen.