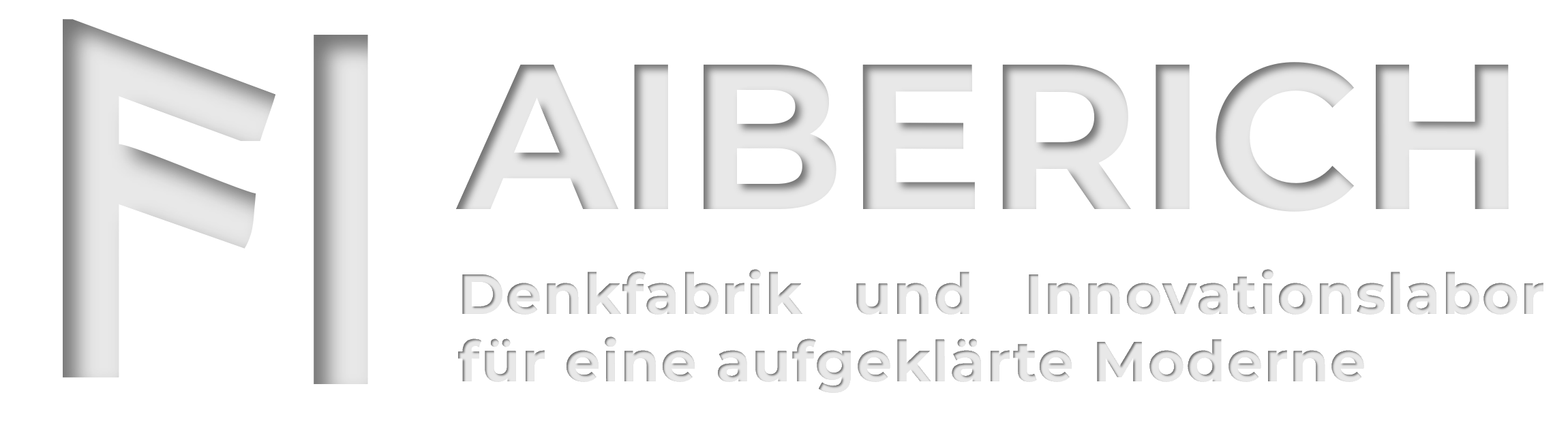Das halbe Paradies und die falsche Arbeit
Was wenn "Fake Work" nicht Ausdruck schlechter Organisation ist, sondern eine schlechte Lösung eines echten Problems.
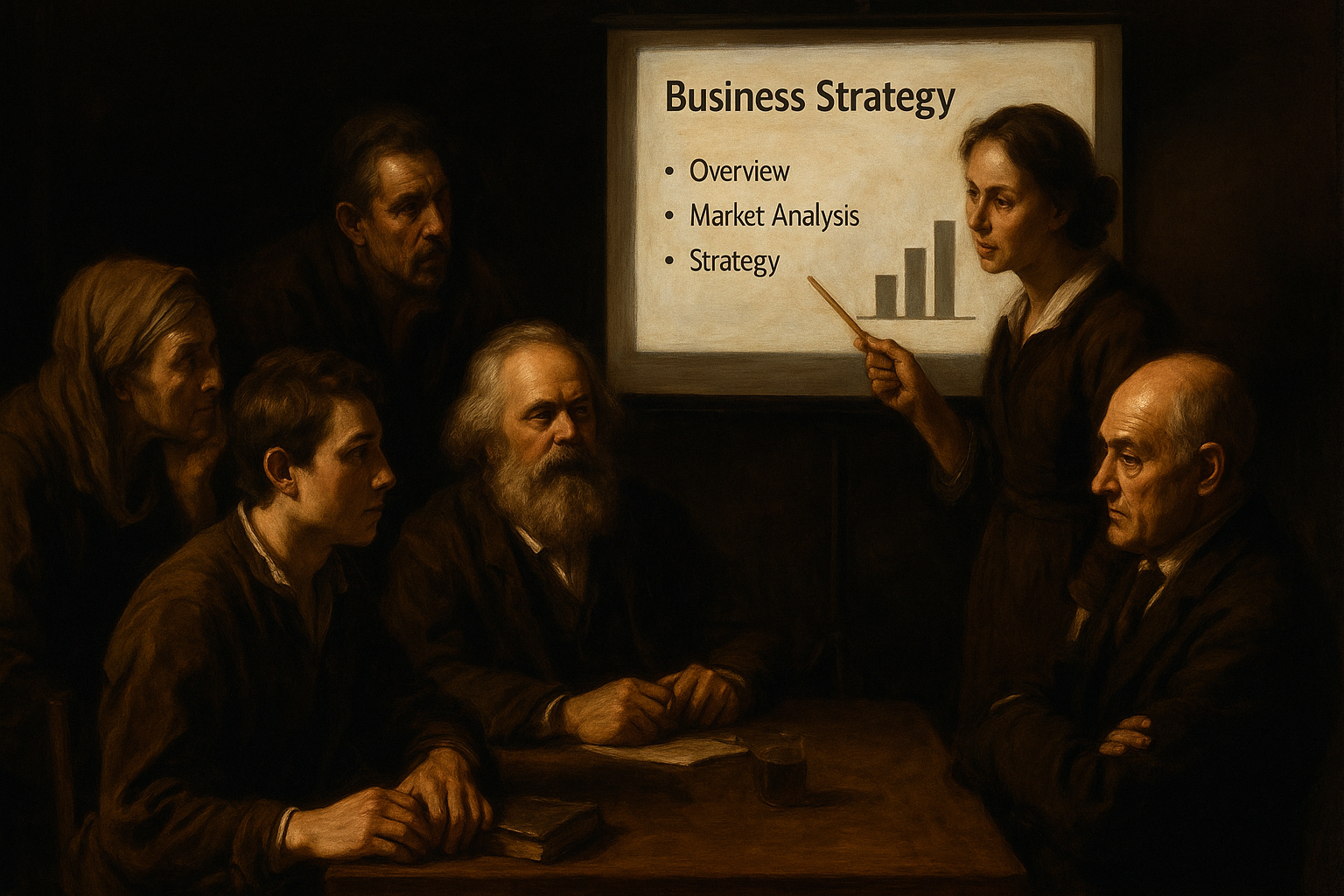
Montagmorgen, halb zehn. Der Bildschirm leuchtet, das erste Meeting beginnt – Thema: Abstimmung zum nächsten Abstimmungstermin. Man klickt sich durch Tabellen, nickt, schreibt Protokoll. Eine Stunde später: das nächste Meeting. Danach E-Mails, Rückfragen, ein Workshop, der das Problem lösen soll, das der letzte Workshop nicht gelöst hat. Am Ende des Tages bleibt das merkwürdige Gefühl: Man war beschäftigt, aber nicht unbedingt tätig.
„Fake Work“ nennen das manche – ein Begriff, der mittlerweile ganze Bücher füllt und Karrieren erklärt. Gemeint ist Arbeit, die so tut, als wäre sie notwendig. Tätigkeiten, deren gesellschaftlicher Nutzen schwer zu greifen ist, aber deren organisatorischer Aufwand umso größer scheint. Besonders verbreitet in Büroetagen, aber längst nicht nur dort. Die Pointe: Es sieht aus wie Arbeit, es fühlt sich an wie Arbeit, aber es ist keine.
Was wäre, wenn das kein Betriebsunfall des Kapitalismus ist – sondern sein unausweichlicher Endzustand? Wenn wir längst in einer Welt leben, in der viele Tätigkeiten nur deshalb existieren, weil man sonst offen eingestehen müsste: Wir brauchen die ganze menschliche Arbeitskraft gar nicht mehr.
Und genau hier wird es ernst. Denn diese Vorstellung – zu radikal für die politische Mitte, zu trocken für die Talkshow – wurde schon vor Jahrzehnten formuliert. In einem analytischen Bild skizzierte der Ökonom Wassily Leontief ein Paradox: das sogenannte Paradies-Paradox. Es handelt von einer Welt, in der alles im Überfluss vorhanden ist. Kein Mangel, kein Preis, kein Markt. Eine Welt, in der ökonomisches Denken seinen Gegenstand verliert – gerade weil es sein Ziel erreicht hat.
Zu produktiv für diese Welt
Die Menschheit ist produktiv geworden. Beängstigend produktiv. Ein einzelner Landwirt ernährt heute über hundert Menschen. Eine Handvoll Techniker betreut Roboterarme, die in einer Stunde mehr Autos zusammenschrauben, als eine Fabrik im 20. Jahrhundert an einem Tag schaffte. Künstliche Intelligenzen schreiben Texte, sortieren Bewerbungen, erstellen Diagnosen. Und das alles bei sinkender Lohnquote und stagnierenden Arbeitszeiten.
Längst hat sich eine paradoxe Verschiebung eingeschlichen: Je effizienter unsere Werkzeuge werden, desto weniger scheint die Arbeit an sich gebraucht zu werden – zumindest in klassischer Form. Die Produktivität wächst, aber sie wächst sich aus. Nicht weil sie versagt, sondern weil sie übererfüllt. Viele der Grundbedürfnisse könnten heute mit einem Bruchteil der verfügbaren menschlichen Arbeit gedeckt werden. Doch anstatt diese Freiheit zu genießen, erfinden wir neue Bedürfnisse oder neue Beschäftigungen, um die alte Ordnung zu erhalten.
Denn was tun mit einer Gesellschaft, in der die Arbeit als Grundstruktur des Alltags, als moralische Kategorie, als Verteilungsschlüssel für Einkommen und Sinn wegzufallen droht? Wo die Maschinen nicht mehr bloß unterstützen, sondern ersetzen?
Die Antwort darauf fällt oft ideologisch aus: Arbeit sei „wichtig für den Menschen“, „stiftet Würde“, „formt den Charakter“. Das mag stimmen – aber es verrät auch eine Hilflosigkeit. Denn in Wahrheit wissen wir nicht, wie wir mit einer Welt umgehen sollen, die uns eigentlich nicht mehr braucht. Nicht in Vollzeit, nicht alle gleichzeitig, nicht lebenslang.
Und genau an dieser Schnittstelle zwischen wachsender Produktivität und sinkender Notwendigkeit von Arbeit beginnt das Terrain, auf dem Leontiefs Gedankenexperiment relevant wird. Eine Gesellschaft im Überfluss, eine Ökonomie, die sich selbst entbehrlich macht.
Das Paradox vor der Paradiespforte
Wassily Leontief war kein utopischer Träumer. Er war ein empirisch arbeitender Ökonom, berühmt für die Input-Output-Analyse, ein nüchterner Analytiker wirtschaftlicher Strukturen. Und doch formulierte er ein Gedankenexperiment, das bis heute nachwirkt – weil es eine unbequeme Frage stellt: Was bleibt von der Ökonomie, wenn Knappheit verschwindet?
Er beschreibt ein Szenario, das auf den ersten Blick utopisch klingt: eine Welt, in der alle Güter im Überfluss vorhanden sind. Alles ist verfügbar, niemand muss etwas entbehren. Doch seltsamerweise ist das kein Zustand ungetrübten Wohlstands – denn an der Schwelle zu diesem Paradies sitzen Menschen, die nichts bekommen. Nicht, weil zu wenig da wäre, sondern weil ihnen der Zugang fehlt.
Der Grund liegt in der doppelten Rolle der Arbeit in unserer Gesellschaft. Arbeit dient einerseits der Produktion von Gütern – sie stellt her, was Menschen zum Leben brauchen. Andererseits fungiert sie als Mechanismus zur Verteilung – wer arbeitet, erwirbt Anspruch. Diese beiden Funktionen sind in der Arbeitsgesellschaft traditionell untrennbar miteinander verknüpft.
Wenn nun die erste Funktion – die produktive Notwendigkeit – zunehmend entfällt, etwa durch Automatisierung, Digitalisierung, technologischem Fortschritt, dann stellt sich eine logische Folge ein: Die zweite Funktion – die legitimatorische – verliert ihre Grundlage. Denn warum sollte Anspruch weiterhin an Arbeit gebunden sein, wenn diese Arbeit gar nicht mehr gebraucht wird?
Leontiefs Paradox zeigt damit kein moralisches Dilemma, sondern ein strukturelles Problem: Die herkömmliche Logik der Verteilung bricht in einer Überflussgesellschaft in sich zusammen. Sie hat keinen Hebel mehr, keine Notwendigkeit, keine Rechtfertigung.
Was daraus folgt, ist kein Aufruf zur Veränderung – sondern zunächst einmal ein analytisches Rätsel: Wie soll eine Gesellschaft Wohlstand verteilen, wenn Arbeit nicht mehr als Bedingung dafür dienen kann?
Die Antwort, die viele moderne Institutionen bislang gefunden haben, ist eine Art symbolische Kompensation: Arbeit wird simuliert. Fake Work ist in dieser Lesart nicht Täuschung, sondern Stabilisierung – sie erhält den Zusammenhang von Arbeit und Anspruch künstlich aufrecht, dort, wo er faktisch längst entkoppelt ist. . Der wahre Zweck vieler moderner Tätigkeiten liegt nicht mehr in ihrer ökonomischen Notwendigkeit, sondern in ihrer symbolischen Funktion: sie erzeugen Anspruch. Wer acht Stunden lang in sinnlosen Meetings sitzt, der zeigt damit vor allem eines – dass er verdient hat, was er konsumiert, selbst wenn das, was er leistet, nichts mehr hervorbringt.
Ein Paradox mit Tradition
Leontiefs Paradox wirkt wie eine Abweichung von der ökonomischen Theorie – tatsächlich rührt es an deren Fundament. Denn die moderne Ökonomie beruht auf Knappheit. Die gängigen Modelle – ob mikroökonomisch oder makroökonomisch – setzen voraus, dass Ressourcen begrenzt sind und daher effizient verteilt werden müssen. Preise, so die Idee, sind Signale zur Allokation des Knappen.
Doch was, wenn Knappheit verschwindet – zumindest in Teilbereichen? Dann verlieren diese Signale ihren Sinn. Ohne Knappheit keine Preise, ohne Preise keine Allokation. Der Marktmechanismus wird dysfunktional, weil seine Voraussetzung entfällt.
Diese Einsicht rückt Leontief in die Nähe anderer Kritiker der Grenznutzenschule, etwa Piero Sraffa, der in seiner Preistheorie ebenfalls auf objektive Produktionsverhältnisse statt subjektive Präferenzen abstellte. Gemeinsam ist ihnen der Zweifel, dass die unsichtbare Hand des Marktes unter allen Bedingungen zur sinnvollen Ordnung führt – insbesondere dann, wenn das System produktiver ist, als es sich selbst zugeben kann.
Wohlstand ohne Arbeit?
Die Tür zum Paradies steht offen – aber niemand weiß, wie man hindurchgeht. Leontiefs Paradox legt ein strukturelles Problem offen, das unsere Gegenwart bereits durchzieht: Wenn Arbeit zunehmend überflüssig wird, verliert sie ihre Funktion als Produktionsfaktor und als Verteilschlüssel. Was bleibt, ist die Frage: Wie lässt sich eine Gesellschaft organisieren, in der das hergebrachte Tauschverhältnis „Arbeit gegen Lebensunterhalt“ nicht mehr trägt?
Zunächst: Die klassische Antwort, Wohlstand müsse an Leistung gebunden werden, wird brüchig. Wenn „Leistung“ nicht mehr notwendig ist, um Überleben zu sichern, bleibt sie nur als soziale Erwartung oder moralisches Kriterium bestehen – nicht mehr als ökonomische Notwendigkeit. Die Arbeitsgesellschaft lebt dann von einer Fiktion: dass ihre Mitglieder durch eigene Mühe zum Wohlstand beitragen. In Wirklichkeit sind sie Teil eines Systems, das die allermeisten Produkte und Dienstleistungen längst unabhängig von individueller Anstrengung bereitstellt.
Was aber tritt an die Stelle dieser Fiktion? Einige Vorschläge liegen auf dem Tisch: das bedingungslose Grundeinkommen etwa, das versuchen würde, den materiellen Zugang zu sichern, ohne ihn an Erwerbsarbeit zu koppeln. Oder die Vorstellung einer „Ökonomie der Commons“, in der Produktion und Verteilung kollektiv organisiert werden – jenseits von Markt oder Staat. Wieder andere fordern eine Re-Politisierung der Verteilung selbst: Wenn Arbeit nicht mehr als Maßstab taugt, muss das Gemeinwesen entscheiden, wer was bekommt – eine Aufgabe, für die demokratische Prozesse (noch) kaum vorbereitet sind.
Das eigentliche Problem ist aber tiefer: Unsere Institutionen, unser Denken, unsere Lebensläufe sind auf Arbeit hin entworfen. Sie strukturiert Zeit, Einkommen, soziale Anerkennung. Ihre schwindende Notwendigkeit reißt damit nicht nur eine ökonomische Lücke – sondern eine kulturelle.
Fake Work ist in dieser Perspektive nicht bloß ineffizient, sondern funktional. Sie füllt die Leere, die entsteht, wenn eine Gesellschaft keinen Begriff von Wohlstand ohne Arbeit hat. Sie ersetzt Notwendigkeit durch Präsenz, Produktivität durch Teilnahme, Bedeutung durch Simulation. Sie bewahrt damit – zumindest vorläufig – die soziale Ordnung, deren Fundamente längst erodieren und einen Rest menschlicher Würde: In nutzlosen Meetings festzustecken ist immer noch psychologisch erträglicher als die Feststellung, dass diese Meetings noch nicht mal echte Zeitverschwendung sind, sondern die Gemeinschaft keinen der Teilnehmer des Meetings als Beiträger zum gesellschaftlichen Wohlstand braucht.
Leontiefs Paradox verweist nicht auf eine Lösung, sondern auf eine Leerstelle. Es erinnert uns daran, dass der Wohlstand der Zukunft nicht davon abhängt, wie viel wir noch leisten können – sondern davon, ob wir eine Form finden, ihn zu teilen, wenn Leistung nicht mehr gebraucht wird.
Das halbe Paradies
Das wirklich Ironische an Leontiefs Paradox ist vielleicht nicht, dass es ein utopisches Extrem beschreibt – sondern dass seine Logik bereits in einer Welt greift, die nur teilweise im Überfluss lebt. Das „Paradies“ muss nicht flächendeckend sein, um seine Wirkung zu entfalten. Es reicht, dass es punktuell existiert – in den automatisierten Wertschöpfungsketten, in der hochgradig rationalisierten Verwaltung, in den von Software und Plattformlogik durchwirkten Bürostrukturen.
Das Resultat ist eine absurde Gleichzeitigkeit: Während in sozialen, pflegerischen und pädagogischen Bereichen Arbeitskraft fehlt, sitzen in anderen Sektoren Millionen Menschen in überfüllten Kalendern fest, klicken sich durch Meetings, deren einziger Output ein Folge-Meeting ist. Auf der einen Seite brennt das System vor Erschöpfung, auf der anderen glüht es vor Simulation.
Die Verteilung von Arbeit folgt dabei nicht der realen Notwendigkeit, sondern den historischen Pfaden einer Gesellschaft, die Arbeit an den Markt bindet – nicht an den Bedarf. Arbeit wird dort vergütet, wo sie kapitalisierbar ist, nicht dort, wo sie gebraucht wird. So entstehen paradoxe Zustände: Menschen werden für unnötige Aufgaben bezahlt, während dringende Arbeit unbezahlt oder unterbezahlt bleibt.
In dieser fragmentierten Realität wird Leontiefs Paradox zur Beschreibung eines systemischen Fehlers: Die Logik der Knappheit hat sich in ein System eingeschrieben, das längst Inseln des Überflusses produziert – ohne dass es gelernt hätte, damit umzugehen. Statt die Arbeitskraft dorthin zu lenken, wo sie gebraucht wird, verteidigt das System eine Ordnung, in der Erwerbsarbeit Anspruch generiert – ganz gleich, ob sie sinnvoll ist oder nicht.
Der soziale Sektor kämpft mit Personalnot, nicht weil zu wenig Menschen da wären, sondern weil die gesellschaftlichen Spielregeln verhindern, dass sie dort arbeiten können, ohne selbst ökonomisch abzustürzen. Und zugleich arbeiten anderswo Menschen in Halbsinn oder Vollsinnlosigkeit – nicht, weil es nötig wäre, sondern weil es nötig erscheint, um Zugang zu Wohlstand zu behalten.
Es ist kein vollständiges Paradies – aber es ist genug, um den Widerspruch sichtbar zu machen.
Drei letzte Gedanken zum halben Paradies
Erstens: Die Technologie hat ihr Versprechen nicht eingelöst. Sie wurde lange als Motor der Befreiung gehandelt – von körperlicher Mühsal, von sinnloser Wiederholung, von wirtschaftlicher Notwendigkeit. Doch stattdessen sehen wir: Befreit wurde vor allem das Kapital von der Arbeit, nicht der Mensch von der Mühe. Die gewonnene Effizienz wurde nicht in kollektive Freiheit übersetzt, sondern in individuelle Disziplin. Automatisierung hat selten Arbeitszeit verringert – aber sehr oft die Kontrolle über sie erhöht. Das Versprechen der Emanzipation bleibt technologisch denkbar, aber sozial blockiert.
Zweitens: Das empirische Rätsel der stagnierenden Produktivität könnte genau darin seine Erklärung finden. Die Zahlen wachsen nicht mehr, weil ein wachsender Teil der Arbeitszeit auf Tätigkeiten entfällt, die keinen Output mehr erzeugen – jedenfalls keinen, der sich in traditionellen Produktivitätsmetriken erfassen lässt. Meetings, PowerPoints, Koordination ohne Zweck: All das stabilisiert vielleicht Systeme, aber es produziert nichts. Die Produktivität stagniert, weil die Arbeit ihren Gegenstand verliert. Nicht weil wir zu wenig leisten – sondern weil wir zu viel vortäuschen.
Drittens: Der Akzelerationismus, besonders in der düster-ironischen Spielart eines Nick Land, reagiert auf genau dieses Paradox. Wenn die einzige Möglichkeit, das System zu überwinden, darin besteht, es bis zum Anschlag zu überdrehen – dann wird Beschleunigung zur Methode. Doch die Ironie liegt darin, dass diese Haltung dasselbe Grundproblem bestätigt, das sie zu sprengen vorgibt: Sie denkt Fortschritt weiter als Bewegung, nicht als Bruch. Der Glaube an den Selbstlauf der Technologie wird zur nihilistischen Beschleunigungsfalle. Das System soll kollabieren – aber bitte mit Vollgas.
Was bleibt, ist ein vorsichtiges Fazit: Das Paradies war nie die Gefahr. Die eigentliche Herausforderung ist, dass es nur in Fragmenten auftaucht – und dass wir nicht wissen, wie man damit umgeht. Leontiefs Paradox ist kein Aufruf zur Revolution. Es ist eine analytische Stolperfalle, in der wir bis heute feststecken.