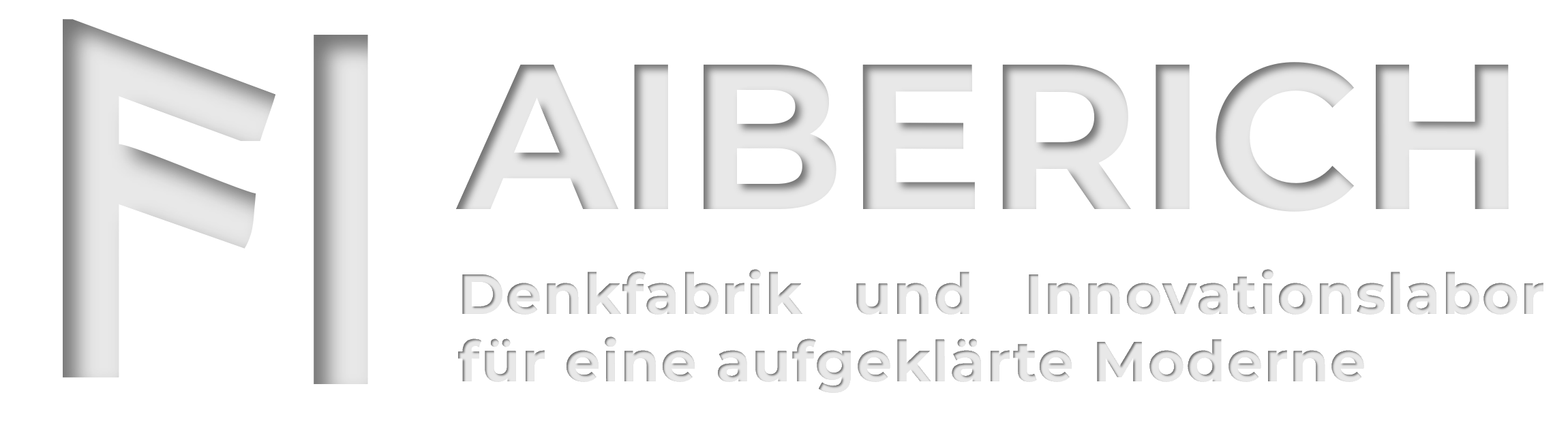Zum Stand der deutschen und europäischen Wirtschaft
Ein Überblick über 35 Jahre misslungene Wirtschaftspolitik und deren Auswirkung.
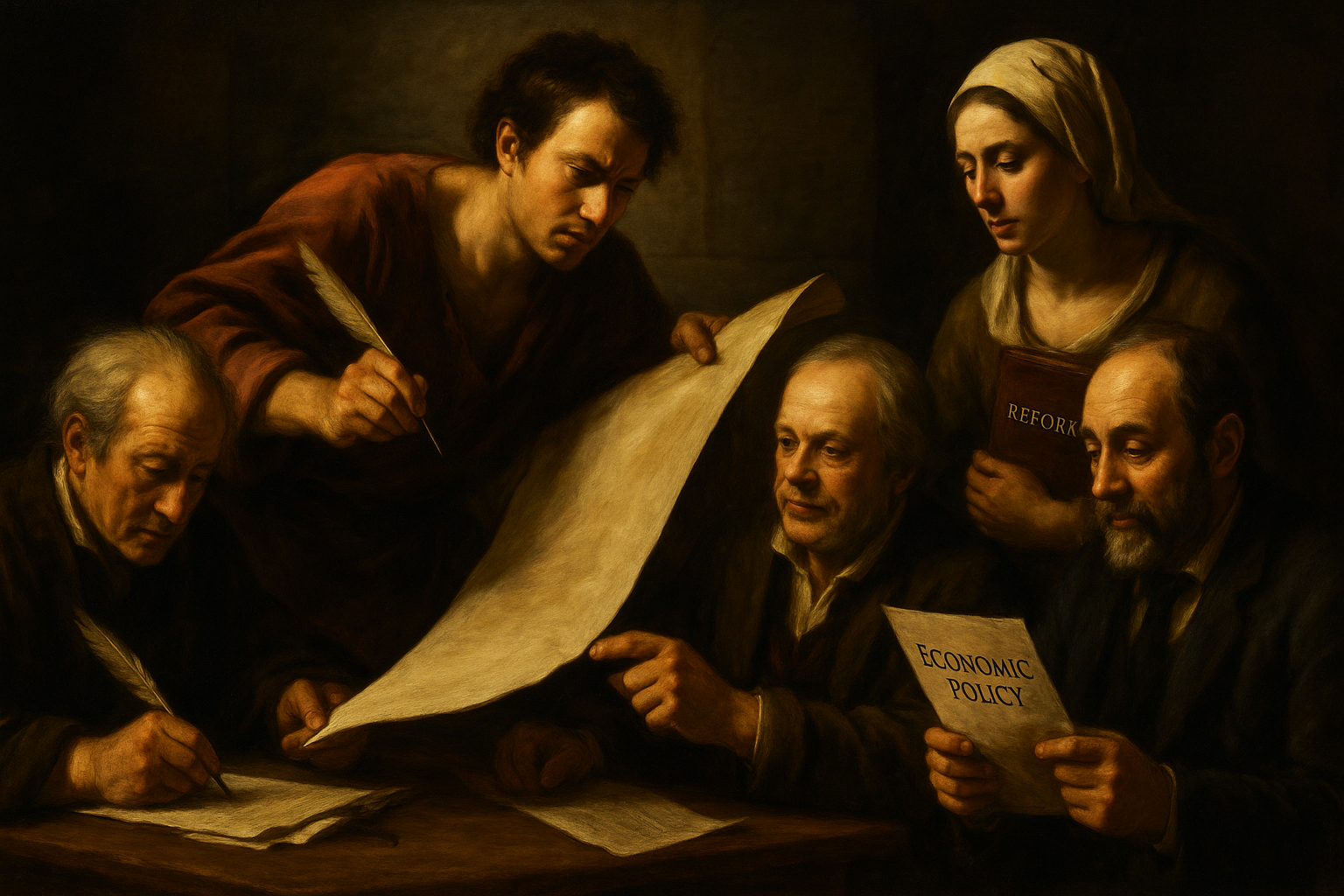
Seit Ronald Reagan den Nachkriegs-Konsens des "new deal" aufgebrochen hat, sind eine spezielle Sorte "Reformen" ein Dauerbrenner der politischen Debatte. Die jüngste Wiederkehr dieses Phänomens in Deutschland waren die Pläne der Union zu einer Agenda2030 im Vorfeld der diesjährigen Bundestagswahl.
Dabei lehnte sich die Union offenbar an die sogenannte Agenda 2010 an. Dieses Reformprogramm wurde um die Jahrtausendwende von der damaligen rot-grünen Bundesregierung mit Unterstützung der Union verabschiedet. Bis heute ist die Agenda 2010 weit über die politischen Lager hinweg umstritten. Viele Armutsforscher machen sie für Armut, mangelnde Teilhabe bis hin zu großflächigem psychischem Leiden verantwortlich.
In der öffentlichen Wahrnehmung diente die Agendapolitik dazu, die Zahl der Arbeitslosen zu reduzieren. Tatsächlich war das aber nur indirekt ihr Ziel.
Die Krise der deutschen Wettbewerbsfähigkeit
Ursache der hohen Arbeitslosigkeit war eine Krise der deutschen Wettbewerbsfähigkeit infolge der Wiedervereinigung. Die Eingliederung der vormaligen DDR war von einer Reihe schwerwiegender Fehlentscheidungen geprägt.
Das vermutlich renditestärkste Geschäft der deutschen Finanzgeschichte ereignete sich für eine Reihe DDR Bürger während der Wende. Wer sein Begrüßungsgeld von 100 DM im November 89 zum üblichen Wechselkurs von 1:27 in 2700 Ostmark tauschte, konnte sich ein Dreiviertel Jahr später darüber freuen, als diese 2700 Ostmark in 2700 DM umgewandelt wurden. Von einer solchen Rendite, 2700%, in weniger als einem Jahr träumt jeder Wertpapierhändler.
Wie die sogenannte Währungsunion ausgestaltet wurde, ist die größte Katastrophe der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Ende 89 war die DDR die neuntgrößte Volkswirtschaft der Erde. Ungefähr fünf Jahre später war diese Wirtschaftsleistung verschwunden. Aus unklaren Gründen beschlossen die Verantwortlichen Politiker und Bürokraten, insbesondere Finanzminister Theo Waigel sowie die Mitarbeiter Horst Köhler und Thilo Sarrazin, die Währungsunion im Verhältnis 1:3 zu vollziehen. Das hätte bedeutet, die Kaufkraft der Ostmark und den Preis jeder ostdeutschen Ware um den Faktor neun zu erhöhen. Tatsächlich wurde die Währungsunion im Verhältnis 1:1 vollzogen. Damit wurde der Preis aller ostdeutschen Waren um den Faktor 27 erhöht, insbesondere alle Löhne.
Die Auswirkungen entsprechen ungefähr dem, was passieren würde, wenn morgen der Mindestlohn auf 300 Euro pro Stunde oder 48000 Euro pro Monat für Vollzeit erhöht würde. Selbstverständlich konnte bis auf wenige Ausnahmen kein ostdeutscher Betrieb unter diesen Bedingungen mit westdeutschen Unternehmen konkurrieren. Daher kollabierte - oder besser: evaporierte - die ostdeutsche Wirtschaft innerhalb weniger Jahre und ihre Reste wurden im Rahmen der Treuhand an westdeutsche Hasardeure verscherbelt. Offiziell wurde diese Abwicklung mit der mangelnden Produktivität der ostdeutschen Wirtschaft begründet. Dieses Defizit entstand aber überhaupt erst durch die Währungsunion. Die Größenordnung dieses Versagens ist enorm: All das würde einem Verschwinden der kanadischen Wirtschaft zwischen heute und dem Jahr 2030 entsprechen.
Natürlich resultierte daraus Massenarbeitslosigkeit in Ostdeutschland. Dadurch dass die ostdeutsche Wettbewerbsfähigkeit durch eine beispiellose Verzerrung des Wechselkurses beschädigt wurde, verschwand für viele Ostdeutsche auch ihre Lebensgrundlage. Sie waren fortan auf das westdeutsche Sozialsystem angewiesen.
Nun kam aber eine Besonderheit des westdeutschen Sozialsystems zum Tragen, die das Problem weiter verschärfte. Der Sozialstaat wird über Beiträge auf die Löhne finanziert und zwar in ungefähr gleichem Teil von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Steigen nun die Ausgaben des Sozialsystems aufgrund politischer Fehlentscheidungen, müssen die Beiträge erhöht werden. Daher führt in Deutschland steigende Arbeitslosigkeit zu höheren Lohnkosten.
Daraus resultiert eine Arbeitslosigkeitsspirale: Je mehr Arbeitslosigkeit, desto höhere Lohnkosten, desto teurer werden Arbeitnehmer, desto weniger Arbeit wird nachgefragt, desto mehr Arbeitslosigkeit. Ab Mitte der 90er war Deutschland in einer solchen Arbeitslosigkeitsspirale gefangen. Nur die boomende Weltwirtschaft rettete die nun gesamtdeutsche Bundesrepublik vor einem wirtschaftlichen Kollaps.
Das Problem machte sich insbesondere in einem drastischen Absinken der Exporte bemerkbar und einem Außenhandelsdefizit. Das hat zur merkwürdigen Fixierung Deutschlands auf Exportüberschüsse geführt. Denn je höher die Lohnkosten in Deutschland sind, desto mehr kosten deutsche Waren und umso weniger werden aus dem Ausland gekauft. Wettbewerbsfähigkeit, Außenhandel und Lohnkosten sind daher eng verwandt.
Wie man eine solche Spirale durchbricht und dabei die europäische Wirtschaft ruiniert
Offenkundig sind diese Probleme zwischenzeitlich verschwunden. Warum sie verschwunden sind, ist allerdings umstritten. Denn es gibt mindestens zwei konkurrierende Erklärungen. Tatsächlich stimmen diese aber beide.
Ab Mitte der 90er kam es zur Politik der Lohnzurückhaltung in den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften, die schließlich sehr nah an Problemen wie Arbeitslosigkeit dran sind, verstanden, dass die Art und Weise, wie die Wiedervereinigung umgesetzt wurde, die gesamtdeutsche Wettbewerbsfähigkeit beschädigt hatte. Daher einigten sie sich in der zweiten Hälfte der 90er mit den Arbeitgebern auf eine kontrollierte Absenkung der Lohnkosten. So wurden etwa Arbeitszeitverkürzungen zurückgenommen und in vielen Branchen die 35 Stunden Woche ohne Lohnausgleich durch eine 38, 40 oder sogar 42 Stunden Woche ersetzt.
Bis 2001 hatte das zu einer Erholung der Wettbewerbsfähigkeit geführt. Seit 2001 hat Deutschland einen ununterbrochenen Außenhandelsüberschuss. D.h. diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass deutsche Waren in größerem Ausmaß vom Ausland gekauft werden, als Deutsche ausländische Waren kaufen. Deutsche Güter waren somit bereits 2001 günstiger als der Weltmarkt und daher das deutsche Lohnniveau – relativ zur Produktivität – unterhalb des Weltniveaus.
Allerdings flogen im September 2001 islamistische Terroristen in das World Trade Center und die sogenannte Dot-Com-Blase platzte an den Börsen. Das führte dazu, dass der Boom der 90er Jahre endete und die Weltwirtschaft in eine Rezession überging. Die Erholung Deutschlands wurde nun also umgekehrt von der Rezession überschattet. Obwohl die Probleme gelöst waren, stieg die Arbeitslosigkeit weiter, weil nun überhaupt weniger Güter nachgefragt wurden.
Damit stieg der Druck auf die Regierung, doch endlich mal was zu unternehmen. Die damalige rotgrüne Regierung griff hierfür Reformen der schwedischen Sozialdemokraten auf. Anfang der 90er Jahre war es in Schweden zu einer Bankenkrise gekommen. Nach einem Regierungswechsel zu den Konservativen und einer Deregulierung des Bankensektors, entwickelte sich eine Spekulationsblase im Immobiliensektor. Diese platzte 1992 und riss die gesamte schwedische Wirtschaft mit runter. Das führte wiederum zu einem Regierungswechsel zurück zu den Sozialdemokraten.
Bis dahin hatte Schweden eine eindeutige Wirtschaftspolitik betrieben, die aus einer permanenten Inflationsspirale bestand. Die schwedische Krone verlor wegen der Inflation ständig an Wert, weswegen die Löhne stiegen, weswegen wiederum die Inflation stieg. Mit dem Regierungswechsel nahmen sich die Sozialdemokraten vor, sowohl die konkreten Probleme zu lösen als auch diesen Kreislauf zu durchbrechen. Das erreichten sie durch eine Reihe von Maßnahmen, die das Lohnwachstum begrenzten, so dass die Krone wertstabil gehalten werden konnte. Diese Maßnahmen betrafen insbesondere eine Begrenzung des schwedischen Sozialstaats, etwa die Erhöhung des Rentenalters oder eine deutliche Reduzierung der Transferleistungen.
Nachdem es 2001 zu einem Skandal um fingierte Vermittlung bei der Arbeitslosenagentur gekommen war, richtete die deutsche Bundesregierung unter dem Personalvorstand von VW, Peter Hartz, eine Kommission ein. Neben einer Reform der Arbeitslosenagentur war die Kommission damit beschäftigt, die schwedischen Reformen auf Deutschland zu übertragen. Daraus resultierte eine Reihe von Gesetzesvorschlägen, die landläufig mit Hartz 1 bis 4 bezeichnet werden.
Das berühmteste Ergebnis dieser Gesetze war die Zusammenlegung und Reform von Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Aus diesen beiden entstand das Arbeitslosengeld 2, das meist als Hartz 4 bezeichnet wurde. Insbesondere diese Maßnahme, aber auch eine Reihe weiterer, trugen wiederum dazu bei, die Lohnkosten zu senken. Sowohl die expliziten Lohnnebenkosten sanken. Zugleich entstand ein Arbeitsmarkt prekär Beschäftigter. Insgesamt erhöhten diese Maßnahmen wiederum die deutsche Wettbewerbsfähigkeit.
Als sich die Weltwirtschaft ab 2005 begann zu erholen, löste dies einen gigantischen Boom der deutschen Wirtschaft aus. Deutschland eilte von einem Exportrekord zum Nächsten.
Hinzu kam, dass ein Korrekturmechanismus außer Kraft gesetzt wurde. Normalerweise hätte diese Senkung des Lohnniveaus und infolgedessen der Preise deutscher Waren Auswirkungen auf die Währung gehabt. Je günstiger deutsche Waren sind, desto mehr werden davon gekauft. Da diese Waren in deutscher Währung bezahlt werden, wird also mehr deutsche Währung gekauft. Wenn mehr deutsche Währung gekauft wird, steigt ihr Preis. Das passiert so lange, bis sich ein niedrigeres Lohnniveau und der Wechselkurs der Währung so ausgeglichen haben, dass Exporte und Importe im Gleichgewicht sind. Die Senkung der Löhne hätte somit zu einem Anstieg der Wechselkurse führen müssen.
Dieser Mechanismus wurde aber durch die Einführung des Euro ausgehebelt. Denn steigt der Preis des Euro, weil mehr deutsche Waren gekauft werden, erhöht sich auch der Preis französischer oder griechischer Waren. Erhöht sich der Preis französischer oder griechischer Waren, werden weniger davon gekauft. Daher gleicht sich der Wert des Euro darüber aus, dass für jede deutsche Ware die mehr verkauft wird, andere europäische Waren weniger gekauft werden.
Der Euro und die beiden Senkungen des Lohnniveaus haben also zusammen zu einem großen Wettbewerbsvorteil der deutschen Wirtschaft geführt, der den Boom der deutschen Wirtschaft in den letzten 20 Jahren erklärt. Die deutsche Wirtschaft ist außerordentlich gewachsen, weil sie Lohndumping auf Kosten des restlichen Euroraums betreibt. Daher sind trotz dieses Wachstums die Reallöhne kaum gestiegen und die öffentliche Infrastruktur verkommen.
Aber natürlich sind die dramatischsten Probleme dort entstanden, wo durch deutsches Lohndumping ganze Wirtschaftszweige kaputt gegangen sind. Das betrifft einerseits die südeuropäischen Länder und zum anderen die USA.
Durch die Verzerrungen im Wettbewerb mussten die südeuropäischen Länder, um einen halbwegs adäquaten Lebensstandard zu halten Schulden aufnehmen. Aufgrund des Lohndumpings kam es zu einem Abfluss von Kapital aus den südeuropäischen Ländern. Vereinfacht gesprochen mussten Griechen Kredite aufnehmen, um deutsche Anlagen und Fahrzeuge zu kaufen, die sie mit dem, was sie haben, zurückzahlen mussten. Daher nahmen die südeuropäischen Staaten Schulden für Investitionsprogramme und derlei auf, um trotzdem ein Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten. Als es aufgrund des Platzens der Immobilienblase zu einer Bankenkrise kam, waren die südeuropäischen Länder kaum mehr in der Lage, ihre Schulden zu tilgen. Es entstand die sogenannte Eurokrise.
Die Eurokrise ist ein direktes Resultat der deutschen Politik. Die doppelte Senkung der deutschen Lohnkosten führte über den Euro zu einer Verteuerung südeuropäischer Waren. Die wirtschaftliche Schwäche der Südeuropäer ist daher ein Resultat dieser Politik.
Es waren aber vor allem die USA, die von der Senkung der deutschen Lohnkosten betroffen waren. Allein das jährliche Handelsdefizit mit China und Deutschland übersteigt seit den frühen 2000ern das amerikanische Wirtschaftswachstum. Die amerikanischen Verbraucher und Unternehmen kauften allein in den 2010ern ungefähr 600-800 Milliarden Euro mehr an deutschen Waren und Dienstleistungen, als sie nach Deutschland exportierten. Während die USA nicht der wichtigste deutsche Handelspartner sind, sind sie aber mit Abstand dasjenige Land mit dem größten Handelsungleichgewicht.
Das führte in ähnlicher Weise wie im Fall der Südeuropäer zu einem stetigen Kapitalabfluss in der Industrie. Eine Vielzahl amerikanischer Unternehmen wurden selbst auf ihrem eigenen Heimatmarkt verdrängt. Die Deindustrialisierung ganzer Landstriche in den USA ist ein direktes Resultat der deutschen und chinesischen Wirtschaftspolitik.
Auf der anderen Seite müssen die Amerikaner, um deutsche Waren zu kaufen, oder die deutschen Unternehmen, um mit den Einkünften aus dem US Geschäft etwas anfangen zu können, Dollars in Euros tauschen. Da der Handelsfluss eine Schlagseite hat, gibt es somit viele Dollars, die nicht gebraucht werden, um damit amerikanische Güter zu kaufen. Diese Dollars liegen bei deutschen Geschäftsbanken herum. Um damit Geld zu verdienen, investieren die Banken sie in die amerikanischen Kapitalmärkte, in Aktien, Fonds oder Staatsanleihen. Daher führt das Handelsdefizit der USA zugleich zu einer Kapitalschwemme auf den amerikanischen Finanzmärkten.
Hinzu kommt, dass das Handelsungleichgewicht durch Kredite finanziert werden muss. Im Ergebnis geben daher deutsche und chinesische Banken den Amerikanern Kredite, mit denen diese deutsche und chinesische Waren kaufen können.
Um eine Stabilität auf den Finanzmärkten aufrechtzuerhalten, musste diese Kapitalschwemme in Form einer Vielzahl von Wertpapieren und Anlagen mit sicheren Wertpapieren kombiniert werden, um das Risiko einer drastischen Wertminderung zu senken. Daher wurden die verschiedenen Wertpapiere mit Derivaten aus Immobilienkrediten kombiniert. Immobilienkredite galten den Akteuren am Finanzmarkt als besonders ausfallsicher.
Allerdings gab es dabei eine problematische Feedbackschleife. Je mehr ausländische Güter gekauft wurden, desto mehr Kapital war im Umlauf. Je mehr Kapital im Umlauf war, desto größer war die Nachfrage nach Kreditderivaten aus Immobilienkrediten, um damit komplexe Finanzprodukte abzusichern. Je größer die Nachfrage nach diesen Kreditderivaten war, desto mehr Immobilienkredite konnten die Banken weiterverkaufen. Je mehr Kredite sie verkaufen konnten, desto mehr Kredite konnten sie vergeben und desto laxer wurden die Konditionen. Im Endeffekt galten die Annahmen über Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Immobilienkredite, die vergeben worden waren, gar nicht mehr. 2007 platzte die dadurch entstandene Blase.
Daher resultiert auch die Finanz- und Bankenkrise selbst zumindest teilweise aus den Senkungen der deutschen Lohnkosten. Zwar trugen auch eine ganze Reihe anderer Entwicklungen und Fehlentscheidungen zur Finanzkrise bei. Ohne die Agenda 2010 und die zusätzliche Kapitalschwemme, die sie brachte, wäre es jedoch vermutlich nicht zur Finanzkrise gekommen.
Die Verschärfung der Innovationskrise
Die beiden Senkungen der Lohnkosten haben noch eine weitere Konsequenz. Investitionen müssen eine Rendite abwerfen, um getätigt zu werden. Kein Unternehmen stellt sich neue Maschinen in die Fabrik, wenn es nicht die Hoffnung hat, dass sich die Anschaffungskosten irgendwann gelohnt haben werden. Diese Rendite kann nur aus einer Quelle stammen: Indem die Investition die Produktivität erhöht. In diesem Fall spart die Investition Arbeitszeit, die dann entweder anders eingesetzt werden kann oder nicht mehr benötigt wird. Offenkundig gilt daher: Je niedriger die Lohnkosten, desto niedriger die eingesparten Kosten und desto geringer die Rendite von Investitionen. Reformen wie die Agenda 2010 senken somit die Rendite von Investitionen, die die Produktivität steigern.
Seit den 70ern haben wir in den westlichen Staaten ein kontinuierliches Sinken des Produktivitätswachstums. Noch steigt die Produktivität, aber sie hat fast ein Plateau erreicht. Im krassen Kontrast zur Wahrnehmung war keine Phase seit der industriellen Revolution von so wenig technischen und ökonomischen Veränderungen betroffen. Während wir abends von einer KI vorgeschlagen bekommen, was wir uns anschauen, sitzen wir währenddessen in einem Gebäude aus der unmittelbaren Nachkriegszeit und haben den Tag in einer Arbeitsumgebung verbracht, in der Maschinen und Anlagen meist auch so oder ähnlich bereits in den 50ern und 60ern herumstanden.
Warum diese Politik wiederholen?
Während die katastrophalen Auswirkungen der deutschen Wirtschaftspolitik außerhalb Deutschlands Konsens sind, werden sie in Deutschland nicht zur Kenntnis genommen. Die Gründe für die Zollpolitik Donald Trumps tauchen bemerkenswerterweise in der Berichterstattung darüber nicht auf. Die Zölle erscheinen aus der Luft gegriffen, obwohl alle Regierungen der USA seit Obama versucht haben, Druck auf Deutschland auszuüben, um Änderungen herbeizuführen.
Zugleich sind die Auswirkungen auf Deutschland katastrophal. Die soziale Ungleichheit, Kinderarmut und Obdachlosigkeit sind deutlich gestiegen. Deutschland gehört nicht mehr - wie in der gesamten Nachkriegszeit - zum Klub der Länder mit verhältnismäßig niedriger Einkommensungleichheit. Stattdessen sind wir mittlerweile gemessen am sogenannten Gini-Koeffizienten ein Land mit mittlerer Ungleichheit. Zugleich verfällt die öffentliche Infrastruktur. Während der Fußball-Europameisterschaft 2024 wurde die notorische Unzuverlässigkeit des öffentlichen Nahverkehrs zum internationalen Gespött. Noch heruntergekommener sieht nur die durchschnittliche deutsche Fabrik aus. Während Drehen und Fräsen in modernen CAD/CAM-Maschinen im Prinzip vollständig automatisiert werden kann, sitzen die meisten Industriemechaniker vor Maschinen, die schon im zweiten Weltkrieg zum Einsatz gekommen sind. Wenn Arbeit billig ist, lohnen sich keine teuren Maschinen
Was bringt es einer Partei, eine Politik mit solchen Konsequenzen zu betreiben? Offenkundig gibt es niemanden, der davon profitiert. Noch nicht einmal die vorschnelle Antwort, dass davon die Kapitalistenklasse profitieren würde, stimmt wirklich. Berücksichtigt man die Abschreibungen, den Wertverlust des deutschen Anlagevermögens, wiegen die langfristigen Probleme die kurzfristigen Gewinne auf. Viele Unternehmer haben kurzfristig höhere Gewinne durch langfristig niedrigere Kapitalausstattung finanziert. Für nicht wenige war das ein Nullsummenspiel.
Daher: Warum eine so blödsinnige Politik, von der niemand profitiert, wiederholen? Das Problem besteht in einer Mischung aus organisatorischem Unvermögen, ideologischer Borniertheit und einer Vielzahl von Fehlsteuerungen.
Wenn der Geschäftsführer eines Unternehmens nach den Problemen für sein Unternehmen gefragt wird, gibt er keine dezidierte Analyse der komplexen Wechselwirkungen der Weltwirtschaft. Er wird vielmehr diejenigen Dinge nennen, mit denen er im Alltag konfrontiert ist: Auflagen, die ihn daran hindern, einfach zu tun, was ihm in den Kopf kommt, dass er qualifizierte Arbeitskräfte nicht in beliebiger Quantität zu einem niedrigen Gehalt findet, die Konkurrenz aus China, die Angst vor US-Zöllen, Probleme in der Logistik im Falle geopolitischer Konflikte, Zugang zu Ressourcen oder Vorprodukten, etc. Daher reagieren politische Akteure, die zwar nahe an den leitenden Akteuren der Wirtschaft, nicht aber an der Wirtschaft als komplexem System, in einer Weise, die diese Probleme zu lösen versucht, ohne deren Ursachen zu beheben.
Diese Lösungsversuche sind es, die zu Verwerfungen in der Wirtschaft führen. Sie sind der Versuch, Lungenkrebs mit Hustentabletten zu beheben und auf die Verschlimmerung des Krebses mit einer Erhöhung der Dosis Hustentabletten zu reagieren. Wie Alexander Horn[1] sehr clever dargelegt hat, sind es gerade die Versuche Wohlstandsverluste während Krisen abzufedern, die zu langfristigen Wohlstandsverlusten führen. Es braucht einfach eine andere Wirtschaftspolitik, um wieder wirtschaftliche Dynamik zu entfachen und den Wohlstand, im Sinne einer Verbesserung der Lebensbedingungen, in Deutschland und der Welt zu erhöhen. Insbesondere aber braucht es einen Mentalitätswechsel, dass eine Wirtschaftspolitik gescheitert ist, die darauf hofft, durch gezielte Wohlstandsverluste wirtschaftliche Dynamik zu entfachen, im Regelfall aber bloße Strohfeuer entzündet.
[1] Alexander Horn: Die Zombiewirtschaft